


wilde seele

Wie wir mit Verzweiflung anders umgehen können
Angesichts der aktuellen Weltlage, Krisen, Kriegen und Klimaveränderung, passiert es den meisten von uns, dass wir zumindest zeitweise überfordert und verzweifelt reagieren. Es scheint angemessen, bezogen auf die vielen Krisenherde und das daraus resultierende Leid, dass wir überwältigt sind, und Trauer, Ohnmacht und Wut empfinden. Angesichts auch der Menge von Bildern und Nachrichten fühlen wir uns klein, haben mit unseren eigenen Ängsten zu kämpfen und wissen auch damit nicht wirklich umzugehen.
Möglicherweise reagieren wir darauf, indem wir andere dafür verantwortlich machen: "Wie kann ich als Einzelperson eine Veränderung bewirken?", "Das muss auf politischer Ebene entschieden werden und die Wirtschaft muss sich dafür ändern." Wir werfen anderen vor: "Die Mehrheit kümmert das gar nicht..." Dadurch haben wir das Gefühl, keinen Einfluss zu haben. Oder wir reagieren auf unsere Überforderung, indem wir uns auf unterschiedliche Weise ablenken und durch Konsum betäuben.
Wenn wir dabei bleiben, dass eben die anderen sich ändern müssen, teilen wir die Welt in zwei Lager: diejenigen, die Macht haben, aber gleichgültig sind und sich weigern einzugreifen, und diejenigen (wir), die die Bedrohlichkeit der Situation sehen, aber sich dadurch hilflos und verzweifelt fühlen. Wir geben dadurch auch viel Macht an scheinbare Entscheidungsträger ab; vor allem aber bleiben wir durch diese Sichtweise in den Gefühlen von Überforderung und Hilflosigkeit stecken.
Nochmal: Wut, Angst und Ohnmacht können temporär angemessene Gefühle auf Gefahrensituationen und Krisen sein. Sie dienen auch dazu, uns wachzurütteln, die Situation zu verarbeiten oder sind vielleicht alte Überlebensmuster. Längerfristig zeigt sich darin jedoch eher ein Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Wir sind überzeugt, dass wir nichts ausrichten/ändern können und verharren in dieser Haltung. Wir bleiben damit aber auch in unserer Komfortzone, weil wir unseren Einfluss unterschätzen.
Das Problem ist: Weder Gleichgültigkeit (die wir anderen vorwerfen), noch die Verzweiflung, die wir fühlen, sind hilfreiche Zustände, die etwas bewirken. Vielmehr haben beide eine Gemeinsamkeit darin, dass der Verantwortung ausgewichen wird. Gleichgültigkeit führt dazu, dass Verantwortung abgegeben und geleugnet wird; Verzweiflung entsteht, wenn wir glauben, alles allein bewältigen zu müssen und zu viel Verantwortung auf uns lastet. Wir sind nicht zuständig, die Probleme der Welt im Alleingang zu lösen.*
Welche Wege führen also aus diesem Zustand hinaus bzw. wie können wir besser damit umgehen, wenn wir verzweifelt sind?
1. Uns auf die Dinge fokussieren, die wir kontrollieren können. Wenn wir uns ausreichend Zeit gegeben und erlaubt haben, unsere Gefühle angesichts der aktuellen Weltlage zu fühlen, sollten wir versuchen, innerlich etwas Abstand dazu zu nehmen und uns zu fragen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten möchten. Statt uns auf die überwältigenden Nachrichten zu konzentrieren oder aber sie komplett zu ignorieren (zwei Kehrseiten derselben Medaille), könnten wir herausfinden, an welchen Stellen wir Einfluss nehmen können. Zum Beispiel: Wie könnten wir uns politisch engagieren? Mit wem könnten wir dazu in Kontakt treten? Gibt es in unserer Nähe Veranstaltungen oder Gruppen von Gleichgesinnten?
2. Bei unseren Stärken, in unserem Einflussbereich beginnen. Es hilft auch, nicht (nur) zu weit über unseren Radius hinaus zu denken, sondern in unserem Alltag, bei unserem Beruf, oder bei den Dingen, die wir gut können, anzufangen. Gibt es eine Fähigkeit, die wir einsetzen oder zur Verfügung stellen können? Können wir gut kommunizieren und für gute Ideen einstehen und mit anderen darüber diskutieren? Können wir lokale Hilfsangebote unterstützen? Wie können wir dafür sorgen, dass das Thema, das uns am meisten interessiert, ein kleines Stückchen weitergetragen wird (in unserer Stadt, in unserem Unternehmen, in der Nachbarschaft etc.)?
3. Kleine Schritte machen. Wenn der Schritt zu groß zu sein scheint ("Was, ich soll mich nach Feierabend noch ehrenamtlich oder politisch engagieren?"), mach den Schritt kleiner. Zum Beispiel beginne zunächst damit, dich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Vielleicht fällt dir dabei ja ein Projekt auf, bei dem es sogar Spaß machen würde, teilzunehmen. Oder du überlegst, wen du kennst, der*die immer gute Ideen hat und dich begeistern kann... Oft bleiben wir stecken, weil wir uns zu viel vorgenommen haben. Kleine Schritte zählen - und wenn wir ins Handeln kommen, stärkt dies fast augenblicklich unser Selbstvertrauen.
4. Unsere Gefühle mit anderen teilen. Um nicht bei der Hilflosigkeit und Verzweiflung zu bleiben, hilft es sehr, wenn wir unsere Gefühle mit anderen, denen wir vertrauen, teilen. Es kann ein Telefonat mit einem*er Freund*in sein, die unsere Ansichten teilt, oder wir sprechen unsere Befürchtungen in einer Freundes- oder Projektgruppe aus, die ein ähnliches Ziel hat. Es kann erleichternd sein, die Befürchtungen auszusprechen und wir machen die Erfahrung, dass andere die gleichen Probleme kennen. Es stärkt unser Gefühl, dass wir nicht allein damit sind.
5. Uns eine andere Geschichte über uns selbst erzählen. Wir können uns fragen, was uns daran hindert, uns für etwas einzusetzen. Welche Geschichte erzählen wir uns in solchen Momenten unbewusst über uns selbst? "Das schaffe ich nie.", "Ich bin zu klein (zu schwach, zu hilflos).", "Ich bin nicht klug genug."... Solche Glaubenssätze stammen oft aus der Vergangenheit und haben in der Gegenwart keine Berechtigung mehr. Überlege, welche neue Geschichte du dir über dich erzählen willst, die besser zu dir passt und dich gut unterstützt, beispielsweise: "Ich schaffe das.", "Ich bin stark", "Ich vertraue auf meine Fähigkeiten."
Ich wünsche dir viel Mut und Selbstvertrauen, um die Dinge anzugehen, die Du verändern möchtest.
*Inspiriert wurde dieser Beitrag durch den TED-Talk von Clover Hogan (2021), die sich speziell auf unseren Umgang mit der Klimakrise bezogen hat.

Zum Umgang mit Ängsten: Katastrophendenken unterbrechen
Die negativen Gedanken im Kopf überschlagen sich: "Das Ende wird sicher schrecklich.", "Wenn das geschieht, werde ich sehr lange leiden.", "Wenn ich beim Jobinterview versage, bekomme ich nie wieder eine gute Stelle.", "Das bedeutet sicher, dass wir uns trennen werden."... Es gibt Situationen, in denen wir vom Schlechtesten ausgehen, die Katastrophe in Gedanken schon vorwegnehmen. In solchen Momenten fühlen wir uns, als seinen unsere Ängste bereits Realität, und erleben oft auch ein Gefühl der Hilflosigkeit.
Manche Menschen neigen mehr, andere weniger zum Katastrophendenken. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es sich zudem verstärken: beispielsweise bei Menschen die zu Ängsten neigen, eine Angststörung oder Depression haben, bei Stress, in belastenden Lebenssituationen, bei größeren Veränderungen. Die katastrophisierenden Gedanken sind der Situation nicht mehr angemessen, sie verzerren die Wahrnehmung und steigern sich zu irrationalen Ängsten.
Auch wenn uns bewusst ist, dass die Befürchtungen unrealistisch sind, können wir dadurch die Gedankenkette nicht immer beenden. Hilfreich kann sein, sich auch die schützende Funktion unserer Ängste ins Gedächtnis zu rufen. Die Absicht dahinter ist, dass wir uns vorbereiten und gegebenenfalls unser Verhalten ändern. Das Katastrophisieren kann aber ebenso den Ausgang der Situation negativ beeinflussen oder sogar dazu führen, dass wir bestimmte Erfahrungen vermeiden.
Wie stoppe ich die irrationalen Ängste?
Wie also können Katastrophengedanken unterbrochen werden? Eine gute Methode dazu, die auch selbstständig angewendet werden kann, stammt aus der Rational Emotiven Verhaltenstherapie nach Albert Ellis. Sie geht davon aus, dass negative Überzeugungen zu den immer gleichen Ergebnissen führen und dass sich diese Überzeugungen jedoch auch ändern lassen. Dies geschieht durch die nachfolgenden vier Schritte:
1. Den Gedanken benennen: Im ersten Schritt gilt es, das Katastrophisieren zunächst zu erkennen und sich den vorherrschenden Gedanken/die Grundangst bewusst zu machen. Welches Ereignis löst den momentanen Gefühlszustand aus? Was genau fühle bzw. befürchte ich? Formuliere den Gedanken so konkret wie möglich, zum Beispiel: "Alle werden mich auslachen." oder "Ich werde die Kontrolle verlieren." oder "Ich werde niemals eine*n (neue*n) Partner*in finden."
2. Den Gedanken zu Ende führen: Die meisten Ängste beherrschen uns dadurch, dass wir sie nicht weiterdenken bzw. nicht zu Ende führen. Deshalb sollten wir uns gezielt erlauben, die Befürchtungen bis zum Ende zu denken. Dazu helfen die folgenden Fragen: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Was würde dann als nächstes passieren? Wie befürchtest du, dass sich die Situation dann weiterentwickelt? ... Also zum Beispiel: Was würde passieren, wenn du beim Vorstellungsgespräch versagst? (Mögliche Antwort: "Ich lande unter der Brücke.") Was wäre dann? ("Ich wäre allein und würde sterben.") Allein durch dieses Weiterdenken kann schon die Absurdität des Gedankens klarer werden.
3. Die Überzeugung überprüfen und hinterfragen: Sind die Befürchtungen bis zum Ende gedacht, können auf unterschiedliche Weise hinterfragt werden. Eine eher rationale Überprüfung ist: Wie wahrscheinlich ist es, dass das befürchtete Szenario eintritt? Ist auch ein anderer Ausgang der Situation möglich oder sogar wahrscheinlicher? Hast du so etwas schon einmal erlebt? Hast du auch schon einmal einen guten Ausgang einer solchen Situation erlebt? Wie kann das aussehen? Ein pragmatisches Hinterfragen kann lauten: Hilft mir dieser Gedanke, mit der Situation aktuell umzugehen? Was kann ich realistisch tun, wenn etwas Vergleichbares eintritt?
4. Eine hilfreiche Überzeugung finden: Das Katastrophisieren wirkt in den meisten Fällen wenig förderlich und unterstützend. Gibt es einen Gedanken, der hilfreicher und realistischer ist und den positiven Ausgang der Situation besser unterstützt? Was würde dir in dieser Situation gut tun zu hören? Wenn es möglich ist und du es dir erlaubst: Wie kann ein positiver Ausgang der Situation aussehen? Es geht nicht darum, Ängste mit positiven Gedanken zu "übertünchen". Vielmehr geht es darum, auch neue Vorstellungen darüber zuzulassen, wie es im besten Fall laufen kann, und dadurch neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken.
Du hast den Einfluss, das Katastrophendenken Schritt für Schritt zu hinterfragen und kleiner werden zu lassen. Da die negativen Gedanken für uns meist vertrauter sind als die Best-Case-Szenarien, gelingt das am besten, wenn wir es so oft wie möglich wiederholen (das haben wir mit den Katastrophengedanken unbewusst auch getan...). Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren der Methode und einem neuen Umgang mit deinen Ängsten!
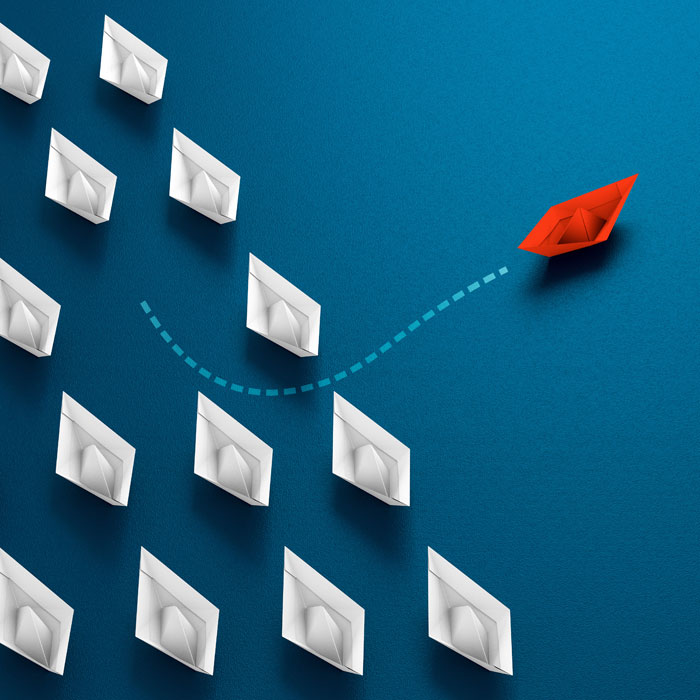
Die Ausnahmen-Methode
Manche Situationen fühlen sich für uns so festgefahren an, dass es uns schwerfällt, eine andere Perspektive einzunehmen oder einen Ausweg zu sehen. Egal wie wir uns dem Problem annähern, scheint das Ergebnis immer nur negativ zu sein. Zum Beispiel: "Ich streite immer mit meiner Mutter." oder "Ständig fühle ich mich gestresst und erschöpft." oder auch "Ich schaffe es einfach nie rechtzeitig zum Sport." An den Beispielen fällt auf, dass wir durch unsere Sichtweise das Problem generalisieren ("immer", "ständig" etc.) und es persönlich nehmen ("ich...").
Wenn die negativen Sichtweisen überwiegen, entsteht oft eine Negativ-Spirale, aus der es schwerfallen kann auszusteigen. Hier hilft die Ausnahmen-Methode, um die Perspektive zu erweitern und unsere Ressourcen bewusst zu machen. Sie ist eine der Gesprächstechniken, die auf den US-amerikanischen Psychotherapeuten Steve de Shazer zurückgehen. Sie lenkt den Blick auf kleinste Verbesserungen in der Vergangenheit und stärkt so unseren Möglichkeitssinn. Dadurch fällt leichter, festgefahrene Verhaltensweisen zu überprüfen und zu ändern.
Wie funktioniert die Methode (Vorgehensweise)?
1. Das Problem vergegenwärtigen: Es lohnt sich, zunächst einmal das Problem, das verändert werden soll, in einen konkreten Satz zu fassen. Also beispielsweise:
- "Ich schaffe es einfach nicht, mich gesund zu ernähren."
- "Ich komme immer zu spät."
- "Ich bin einfach so ängstlich."
- "Ich schaffe es einfach nicht, meine Arbeit rechtzeitig abzuschließen."
2. Den Satz ergänzen: Den Satz sprachlich zu ergänzen ist eine zusätzliche Methode, um die bisherige Sichtweise zu hinterfragen. Dazu werden die Worte "bisher" und "oft/häufig" in den Satz eingefügt. Die Sätze können dann zum Beispiel so lauten:
- "Bisher habe ich es oft nicht geschafft, mich gesund zu ernähren."
- "In der Vergangenheit bin ich häufig zu spät gekommen."
- "In der Vergangenheit war ich oft ängstlich."
- "Bisher habe ich es oft nicht geschafft, meine Arbeit rechtzeitig abzuschließen."
Wie hören sich diese Sätze jetzt im Unterschied zu den ersten generalisierten Sätzen an? Erscheint dadurch das Problem etwas überschaubarer und leichter?
Der Vorteil dieser sprachlichen Ergänzung ist, dass sie die Absolutheit der eigenen Annahme auflöst. Das Problem wird sprachlich so gefasst, dass es seiner tatsächlichen Größe entspricht. Die sprachliche Neufassung genügt oft schon, um dem Problem die Last zu nehmen, etwas Raum zu schaffen für den Gedanken, dass es nicht immer so war und nicht immer so bleiben muss. Das kann schon eine Erleichterung bewirken.
3. Die Suche nach Ausnahmen: Dies ist die eigentliche Methode. Wann ist das Problem in der Vergangenheit einmal nicht aufgetreten? Gab es Situationen, in denen du dich anders verhalten hast, zum Beispiel indem du pünktlich warst, dir selbst ein gutes Essen zubereitet hast, mutig warst etc.? Was genau war in dieser Situation anders? Es geht darum, sich wieder an die vergangene Situation zu erinnern und sie zu erforschen.
Hilfreiche Fragen können dabei sein: Was hast du anders gemacht? Was haben andere Personen anders gemacht? Wie hast du geschafft, dass in diesen Situationen das Problem nicht aufgetreten ist? Was brauchtest du dafür? Dadurch wird die Aufmerksamkeit weg von den negativen Selbstannahmen und hin zu den Ressourcen gelenkt, die du bereits besitzt. Und du kannst überlegen, was davon ab jetzt in anderen Situationen wiederholen möchtest.
Wie alle Methoden hat auch die Ausnahme-Technik Grenzen. Es gibt Probleme, die mindestens zeitweise unveränderbar sind. Das soll durch die Methode nicht einfach verdrängt werden. In diesem Fall geht es mehr darum herauszufinden, wie du mit dem Problem möglichst gut leben kannst.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Erforschen und Wiederentdecken gelungener Ausnahmen!

Morgenseiten – eine kreative Schreibtechnik
Wenn wir schreiben, können wir Dinge verarbeiten, finden wieder unseren Fokus oder können uns davon entlasten, allzu viele Gedanken in unserem Kopf zu tragen. Auch für unsere seelische Gesundheit kann es von Vorteil sein, wenn wir uns kreative Techniken wie das Schreiben angewöhnen. Unter den vielen kreativen Schreibtechniken (Tagebuch schreiben, assoziatives Schreiben, Haikus verfassen etc.) sind die Morgenseiten eine besonders einfache und gewinnbringende Methode, die mit etwas Übung meistens auch noch viel Freude macht.
Was sind Morgenseiten?
Die Grundtechnik der Morgenseiten ist schnell erklärt: Du nimmst dir drei Blätter vor und schreibst darauf ohne Abkürzungen und ohne Unterbrechungen deine Gedanken - ohne Ausnahmen. Das Geschriebene folgt auf diese Weise deinem Bewusstseinsstrom, also zum Beispiel: "draußen scheint die Sonne und ich sitze hier und schreibe. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Was für ein Mist. Ich will aufstehen und das Fenster schließen. Habe ich genug für das Mittagessen eingekauft? Und und und ..." Der Schreibprozess ist vorbei, wenn die drei Seiten vollgeschrieben sind.
Auf diese Weise entleerst du dein Gehirn von allen Gedanken - das ist die Hauptfunktion der Morgenseiten. Nichts ist zu einfach, zu albern oder zu außergewöhnlich, um es auf den Seiten festzuhalten. Sie sollen nicht besonders klug werden - obwohl das vorkommen kann - und es muss noch nicht einmal einen zusammenhängenden Text ergeben. Ihre Wirkung entfalten die Morgenseiten dennoch. Du kannst die Seiten anschließend bewusst weglegen und nicht sofort lesen; du kannst sie aber auch fortlaufend in einem Notizbuch festhalten.
Es kann eine gute Idee sein, bereits morgens nach dem Aufstehen zu schreiben; ebenso gut können die Seiten auch zu einer anderen Tageszeit geschrieben werden. Wichtig ist eher, sich eine Routine anzugewöhnen und sich beispielsweise dafür zu entscheiden, zwei Wochen lang jeden Tag die drei Seiten anzufertigen und dann neu zu entscheiden. Es kann sein, dass das Schreiben am Anfang noch schwerfällt, weil es ungewohnt ist und man sich fragt, was dabei herauskommen soll (oder weil man doch den Anspruch hat, es solle besonders interessant/kreativ/klug werden). Die Methode der Morgenseiten möchte jedoch gerade von allen Ansprüchen und inneren kritischen Stimmen, die uns anfeuern und bewerten, befreien; und wenn man sich daran hält, und trotzdem den schlichten Gedankenstrom niederschreibt, führen uns die Morgenseiten stattdessen wieder zu unseren ureigenen, kreativen Einsichten.
Welche Vorteile haben Morgenseiten?
Wie geht das? Oder anders gesagt, welche Vorteile können Morgenseiten haben? Im Folgenden möchte ich etwas mehr die positiven Effekte von Morgenseiten beschreiben:
- Morgenseiten erhöhen die Kreativität. Sie werden oft auch empfohlen, um Blockaden beim Schreiben zu überwinden. Statt etwas besonders gut oder perfekt machen zu wollen, bringen die Morgenseiten dazu, möglichst frei und absichtslos mit dem Schreiben anzufangen und in den kreativen Fluss zu kommen. Die Kreativität kann sich frei entfalten und neue und unvorhergesehene Ideen können dadurch entstehen.
- Mehr Klarheit - der Kopf wird frei von unwichtigen Gedanken. Wenn wir uns erlauben, alle Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, niederzuschreiben, können wir sie auch leichter loslassen - sie stehen dann schon auf dem Papier; und ohne dass wir es steuern (ohne bewusstes Wollen) tauchen hin und wieder neue, frische Gedanken auf, oder es ergibt sich ein Bild, das wir vorher so noch nicht gesehen haben.
- Morgenseiten schaffen wieder Zugang zu unbewussten, konstruktiven Gedanken und Einsichten. Unser Verstand verläuft linear und wir versuchen meist, Probleme logisch anzugehen. Beim absichtslosen Schreiben werden dagegen unzensiert alle Gedanken aufgenommen und wir lassen auch absurde, unlogische oder unpassende Gedanken erst einmal zu. So können ganz allmählich, ohne dass wir es steuern, neue frische Antworten und kreative Lösungen entstehen/aufgedeckt werden, die schon in uns sind, die aber vom rationalen Verstand überlagert werden.
- Stress wird reduziert. Morgenseiten nehmen den Druck, schnell eine Lösung entwickeln zu müssen, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen oder kreativ sein zu "müssen". Wir entkrampfen unser Gehirn, indem wir mehr beobachten, was darin vorgeht, als dass wir unsere Gedanken in irgendeiner Weise lenken wollen.
- Es bringt einen gesunden Abstand zu Gedanken und Gefühlen. Schreiben kann auch eine Methode sein, um sich mit intensiven Gefühlen auseinanderzusetzen. Auch das kann durch absichtsloses Schreiben geschehen. Wenn wir mit intensiven Gefühlen (Wut, Trauer, Angst etc.) sehr identifiziert sind, kann das Schreiben helfen, wieder mehr Abstand zu gewinnen. Angst- bzw. Gefühlszustände können dadurch abgemildert werden, wenn wir damit einen kreativen Prozess starten.
- Verschafft einen guten Start in den Tag. Manche Menschen benutzen Morgenseiten auch anstelle von Meditation, um bereits am Morgen in einen guten Kontakt mit sich zu kommen und fokussiert und gestärkt in den Tag zu starten. Dafür ist es hilfreich, sich erstmal nach innen zu wenden, bevor der Alltag losgeht.
- Der innere Kritiker/das strenge Über-Ich wird umgangen. Indem nur beobachtet und alles notiert wird, was uns gerade in den Sinn kommt (und auch durch die Regel, den Schreibprozess nicht zu unterbrechen), werden auch alle Bewertungen umgangen, die uns sonst davon abhalten, unseren kreativen Impulsen nachzugehen. "Das ist nicht gut genug.", "Das ist doch lächerlich, was du da tust." können zwar als Gedanken auftauchen und sogar in die Seiten einfließen, wir bleiben jedoch daran nicht hängen.
- Kreatives Schreiben kann uns in schwierigen Lebensphasen Halt und Unterstützung geben. Die Routine der Morgenseiten kann die Tagesstruktur verbessern, und die Freiheit, alles aufschreiben zu können und dadurch möglicherweise auf neue, unerwartete Gedanken zu kommen, kann gerade in Phasen, in denen es uns nicht gut geht oder wir mit Herausforderungen konfrontiert sind, unterstützend sein. Wir wenden uns dadurch uns selbst wertschätzend zu.
Entstanden ist die Methode des "Free writing" übrigens bereits in den 1960er Jahren. Später wurden die Morgenseiten vor allem durch die Autorin und Künstlerin Julia Cameron bekannt. Nach ihr sind sie ein Mittel, um die eigene Kreativität zu erschließen - für künstlerische Prozesse und darüber hinaus.
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen neugierig auf die Morgenseiten machen. Viel Freude beim Ausprobieren und beim Wiederentdecken deiner Kreativität!

Mit dem Wertequadrat zu mehr Balance
Das Wertequadrat ist ein Modell, durch das sich mehr innere Balance herstellen lässt - sei es individuell, für uns selbst, oder in unseren sozialen Beziehungen. Es hilft, unsere persönlichen Werte zu reflektieren und zu erweitern, wenn wir sie zu einseitig leben. In Konflikten können wir mehr Verständnis für die Position des anderen entwickeln und finden leichter gemeinsam neue Handlungsschritte.
Das Wertequadrat basiert auf der Grundannahme, dass jeder unserer Werte oder Eigenschaften einen komplementären, das bedeutet gegensätzlichen Wert braucht, um ausbalanciert zu sein. In uns sind immer schon beide Werte bzw. Eigenschaften vorhanden, in der Regel tendieren wir jedoch zu einer Seite mehr. Zum Beispiel sind wir vielleicht mehr empathisch als selbstfürsorglich oder Kreativität/Freiheit ist für uns ein wichtigerer Wert als Struktur/Ordnung.
Problematisch kann es werden, wenn wir zu sehr zu einer Seite tendieren oder uns in einen Wert hineinsteigern. Wenn wir beispielsweise immer wieder empathisch auf die Bedürfnisse anderer Personen reagieren und uns selbst darüber vergessen oder gar nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich brauchen - vielleicht auch, weil wir gelernt haben, eine Eigenschaft wie "egoistisch sein" abzulehnen.
Das Wertequadrat möchte das Spannungsfeld zwischen diesen gegensätzlichen Seiten ausgleichen und zwischen den Polen vermitteln, statt eine Seite zu grundsätzlich abzulehnen.
Wie verwende ich das Wertequadrat?
Wenn wir eine Seite oder ein Verhalten von uns nicht mögen oder sie uns immer wieder im Weg stehen, können wir uns die Frage stellen, welchen Wert oder welche Eigenschaft wir damit verbinden.
Die darauffolgenden Schritte des Wertequadrats möchte ich an dem Beispiel "Perfektionismus" veranschaulichen. Bildlich können wir uns das Modell als ein Quadrat aus vier Feldern vorstellen, von denen jeweils zwei ein Paar bilden und nebeneinander angeordnet sind.
Diejenige negative Eigenschaft, die wir an uns nicht mögen und bei der es uns schwerfällt, sie zu verändern ("Perfektionismus"), würde im Wertequadrat im Feld unten links stehen. (1)
Im nächsten Schritt können wir uns fragen, was der positive Kern dieser Eigenschaft ist, und kommen dabei vielleicht auf die Eigenschaft (den Wert) "Genauigkeit" oder "Leistungsbereitschaft", der uns sehr wichtig sind. Diese Eigenschaft wird im Wertequadrat links oben eingetragen. (2) Es lässt bereits erkennen, dass die negative Eigenschaft für uns einen durchaus guten und erstrebenswerten Anteil hat.
Anschließend können wir uns fragen, was der positive Gegenwert zu "Leistungsbereitschaft" ist. Das könnte beispielsweise die Eigenschaft "Lockerheit" sein, gemeint als "die Dinge locker angehen", eine entspannte Haltung annehmen. Dieser Wert wird im Feld rechts oben des Wertequadrats eingetragen. (3) Dieses Feld verdeutlicht die Eigenschaft, die uns am wahrscheinlichsten fehlt, wenn wir sehr in einer perfektionistischen Haltung gefangen sind. Nach dem Modell ist dies auch die Qualität, die wir mehr kultivieren sollten, wenn wir nach Veränderung streben.
Darunter, im rechten unteren Feld kann noch eingetragen werden, was das Extrem dieser Eigenschaft sein kann, zum Beispiel "Gleichgültigkeit" als Extrem zu "Lockerheit". (4)
Das Wertequadrat veranschaulicht so zum einen, welche Werte-Paare es gibt (Leistungsbereitschaft - Lockerheit) und weist darauf hin, welcher gegensätzliche Wert gestärkt werden muss, damit ein Gleichgewicht entsteht. Den meisten Menschen fällt es übrigens leichter, sich zu einem neuen positiven Wert hinzuentwickeln, als den negativen Wert/die negative Eigenschaft zu ändern bzw. zu verringern! Zum anderen stellt das Modell die Extreme dar (Perfektionismus - Gleichgültigkeit), die dann entstehen, wenn wir die positiven Werte jeweils besonders stark ausleben.
Um bei dem Beispiel zu bleiben: Wenn ich unter meinem Perfektionismus leide, ist es hilfreich, mich zu fragen, wie ich etwas mehr Lockerheit in mein Leben bringen kann - statt die perfektionistische Seite um jeden Preis abschaffen zu wollen.
Wie hilft das Wertequadrat bei Konflikten in Beziehungen?
In Konflikten mit anderen Menschen kann das Wertequadrat ebenfalls sehr nützlich sein. Wir können uns zum Beispiel fragen:
- Welche Position vertrete ich gerade? Gehe ich davon aus, dass der Wert, den ich vertrete, der einzig "wahre" und positive ist?
- Könnte die Position des*der anderen Person nicht auch eine gute Ergänzung zu meiner Position sein? Eventuell macht sie mich ja auch darauf aufmerksam, welche Eigenschaft bei mir zu gering ausgeprägt ist oder welche ich ablehne.
- Werfe ich meinem*er Partner*in, Freund*in etc. eventuell gerade die Extremeigenschaft vor? Das passiert sehr häufig in Konflikten...
- Gibt es einen guten Kern bei der Eigenschaft des*der anderen Person?
Diese Fragen können das Verständnis für die Position des*der anderen vertiefen. Die Absicht dahinter ist, in Streitgesprächen weniger zu polarisieren und abzuwerten, sondern im besten Fall den Standpunkt des anderen wertzuschätzen. Dann kann gemeinsam nach einem Weg gesucht werden, um beide Positionen mehr ins Gleichgewicht zu bringen.
Von wem stammt das Wertequadrat?
Zuletzt noch ein Hinweis darauf, woher das Wertequadrat stammt. Der Grundgedanke geht auf die Ethik des Aristoteles zurück, der die Tugend als die Balance zwischen zwei Extremen definiert hat. Entwickelt hat das Modell der Philosoph Nicolai Hartmann; und heute ist es insbesondere bekannt durch den Kommunikationswissenschaftler und Psychologen Friedemann Schulz von Thun, nach dem es als Werkzeug für die persönliche Weiterentwicklung und Kommunikationsanalyse verwendet wird.
Ich hoffe, du hast durch den Beitrag einen ersten Eindruck vom Wertequadrat erhalten und wünsche dir viel Freude dabei, deine Werte zu erkennen und ins Gleichgewicht zu bringen!

Sokratischer Dialog
Du darfst nicht alles glauben, was du denkst - diese Haltung könnte auch hinter der Methode des "sokratischen Dialogs" stehen, wie sie in Therapie und Coaching verwendet wird. Unsere Gedanken und Überzeugungen prägen unsere Wahrnehmung der Welt und fühlen sich für uns realistisch an - dabei sind es oft nur subjektive Sichtweisen und Urteile, die keineswegs "wahr" sind. "Ein Leben ohne Konflikte ist ein glückliches Leben. ", "Diese Prüfung bestehe ich sicher nicht.", "Jede Frau wünscht sich, eine Familie zu gründen". "Männer haben die Aufgabe, die Wünsche ihrer Partnerinnen zu erfüllen." ...
Einerseits helfen uns Überzeugungen, damit wir nicht jede Situation neu bewerten und uns für ein neues Verhalten entscheiden müssen. Gleichzeitig können uns gewohnte Sichtweisen daran hindern, neue positive Erfahrungen zu machen. Der Sokratische Dialog hilft uns, festgefahrene Überzeugungen und Glaubenssätze auf die Probe zu stellen und zu hinterfragen.
Der griechische Philosoph Sokrates (469-399 v. Chr.) nahm in Gesprächen häufig eine Position des Nichtwissens ein, d.h. er bewertete nicht und wollte seine Gesprächspartner auch nicht von seinen Ansichten überzeugen. Stattdessen wollte er andere darin unterstützen, ihre Gedanken zu überprüfen und einen eigenen Erkenntnisprozess in Gang zu setzen. Seine Gesprächsführung wurde vor allem durch Fragen charakterisiert ("Ist es nicht so, dass..." oder "Meinst du nicht, dass..."), die eine neue, ungewohnte Position aufzeigten. Damit regte er sein Gegenüber an, eine neue Haltung/Position auszuprobieren oder anzunehmen.
Bei der heutigen Verwendung der Methode werden meist zwei gegensätzliche Thesen diskutiert. Dies kann im Gespräch, während einer therapeutischen Sitzung oder im Coaching geschehen, oder du nimmst dir zuhause die Zeit, zwei Kurzvorträge zu verfassen, in denen du zunächst Argumente für die eine und dann für die andere Seite findest - ohne innerlich zu bewerten, sondern mit dem Ziel, beide Male zu überzeugen.
Wie wird der sokratische Dialog verwendet?
1. Wähle einen Glaubenssatz aus, der dich einschränkt oder andere negative Konsequenzen für dich hat,
z.B. "Ich kann mich für die neue Stelle erst bewerben, wenn ich alle erforderlichen Qualifikationen besitze." oder
"Eine gute Tochter (Freundin/Partnerin/Mutter etc.) ist für die Bedürfnisse ihrer Eltern (Freunde/des Partners/ihrer Kinder) verantwortlich."
2. Formuliere anschließend einen gegensätzlichen Glaubenssatz,
z.B. "Ich kann mich für die neue Stelle auch bewerben, wenn ich (noch) nicht alle erforderlichen Qualifikationen habe." oder
"Eine gute Tochter (Freundin/Partnerin/Mutter etc.) kümmert sich um ihre eigenen Bedürfnisse und kann sich gut abgrenzen."
3. Verfasse für beide Standpunkte einen jeweils etwa gleichlangen Kurzvortrag (ca. 1-1,5 Din A4 Seiten bzw. 3-5 Min Redezeit).
Die Zuhörer*innen sollen nicht erkennen können, welchen Standpunkt du selbst vertrittst, sondern du setzt dich gleichermaßen intensiv mit beiden Positionen auseinander. Bereits das Schreiben und die Beschäftigung mit den gegensätzlichen Positionen kann unsere Sicht der Dinge erweitern und starre Überzeugungen lockern - und darf auch Spaß machen! Auch wenn es zunächst paradox erscheint, gibt es immer auch Argumente für die Gegenseite, die wir nur oft übersehen, weil wir Beweise für unsere bekannte Weltsicht sammeln.
Ein Gewinn aus dem sokratischen Dialog kann sein zu erkennen, dass es bei den Überzeugungen kein "richtig" oder "falsch" gibt, sondern wir uns irgendwann unbewusst für eine Position entschieden haben. Beide Standpunkte sind im Grunde gleichwertig und blockierende Glaubenssätze entsprechen oft mehr unseren (meist irrationalen) Ängsten und Befürchtungen. Indem wir Argumente und Beweise für die andere Seite sammeln, ergibt sich ein vollständigeres Bild.
Wir erhalten die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung zu erweitern - und uns für einen anderen Standpunkt zu entscheiden, der uns besser unterstützt. In jedem Fall sind wir uns bewusster geworden über unsere Glaubenssätze und wurden vielleicht überrascht und ermutigt, unsere Denkmuster zu verändern.
Viel Freude beim Ausprobieren der sokratischen Haltung!

Schuldgefühle vs. Verantwortung
Wenn wir jemanden enttäuscht haben, eine Verabredung vergessen, im Streit verletzende Dinge gesagt haben oder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, empfinden die meisten von uns anschließend Schuldgefühle. Manchmal ist das schlechte Gewissen fast schon ein vertrautes Gefühl, das in bestimmten Kontexten und bei bestimmten Menschen auftaucht. Dann können die Schuldgefühle und Selbstvorwürfe zu einer fast schon automatisch auftretenden inneren Stimme werden, die uns niederdrückt.
Schuldgefühle sind subjektiv, d.h. wie häufig und wie intensiv sie auftreten, ist individuell verschieden. Zwei Menschen in der völlig gleichen Situation können sehr unterschiedlich reagieren und Schuldgefühle entwickeln oder nicht. Wenn sie jedoch wiederholt auftreten, können sie die Gesundheit beeinflussen: Sie können Gereiztheit, Kopfschmerzen oder Magendruck auslösen, oder sogar Ängste und Depression mitverursachen.
Wie entstehen Schuldgefühle?
Schuldgefühle entstehen meistens durch hohe innere Ansprüche an sich selbst. Beispielsweise weil man ein guter Sohn/eine gute Tochter (ideale Ehepartner*in, Freund*in, Mutter, Vater etc.) sein möchte. Immer wenn wir den von uns selbst erhobenen Ansprüchen nicht genügen, kann das schlechte Gewissen einsetzen.
Eine Frage, die wir uns in solchen Momenten auch stellen können, ist: Welches innere Gebot habe ich gebrochen? Denn häufig haben wir früher einmal innere Regeln aufgestellt, an die wir uns immer unbewusst noch halten, wie beispielsweise: "ich darf mich nicht in den Vordergrund stellen", "ich darf nicht faul sein", oder "die Gefühle der anderen Person sind wichtiger als meine". Wenn wir diese inneren Regeln brechen, setzen Schuldgefühle automatisch wie ein Alarmsignal ein. Sie können ein Hinweis auf erlernte Gesetze sein, die wir heute jedoch hinterfragen können.
Was ist der Zweck von Schuldgefühlen?
Früher haben uns solche inneren Regeln vielleicht einmal gut geholfen, eine Situation zu überstehen. Schuldgefühle treten in Beziehungen auf und haben oft eine soziale Funktion: Sie zeigen an, dass wir gegen eine soziale Regel verstoßen haben (diese kann objektiv sein oder auch nicht) und dass wir etwas verändern oder wiedergutmachen müssen, mit dem Ziel, die Beziehung zu stärken.
Daneben schützen uns Schuldgefühle häufig noch vor einem anderen Gefühl, das für die meisten Menschen schwer zu ertragen ist: dem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Für viele ist es tatsächlich leichter, sich schuldig zu fühlen - da es impliziert, dass wir noch Einfluss haben, etwa tun könnten oder zumindest hätten tun können ("es ist meine Schuld, dass ich etwas getan oder unterlassen habe"). Hilflosigkeit dagegen ist verbunden mit dem Gefühl, handlungsunfähig zu sein und nichts mehr tun zu können - eines der schwierigsten menschlichen Gefühle.
Wie lassen sich Schuldgefühle überwinden?
Paradoxerweise lassen uns Schuldgefühle jedoch ebenso in einer Position der Hilflosigkeit verharren: Wir nehmen die Hauptlast der Schuld auf uns, werten uns dafür ab und bleiben gefangen in der Sichtweise, nichts tun zu können, um die Situation zu verändern. Die Schuldgefühle weisen uns nicht den Weg hinaus aus dem Konflikt. Wir können jedoch wieder in eine verantwortungsvolle, reife Position wechseln und uns überlegen, welche Schritte notwendig sind.
1. Das schlechte Gewissen hinterfragen: Der erste Schritt sollte sein, die Situation genauer wahrzunehmen und sich zu fragen, was man glaubt, "falsch" gemacht zu haben. Was hätte ich objektiv besser/anders machen können? Welchen meiner Werte bin ich nicht gerecht geworden? Gegen welche inneren Gesetze habe ich verstoßen? Bei diesem Schritt ist es gut, ehrlich zu sich selbst zu sein, aber auch so objektiv wie möglich zu fragen, was man wirklich unter den gegebenen Umständen hätte tun können.
2. Die Verantwortung akzeptieren: Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir anders hätten handeln können und dass unser Verhalten falsch war, können wir das im nächsten Schritt vor uns selbst akzeptieren. Verantwortung für das eigene Fehlverhalten zu übernehmen, bringt uns selbst einen Riesenschritt heraus aus der Negativspirale der Schuldgefühle und dem Gefühl der Hilflosigkeit - zurück in einen Zustand der Kontrolle. Wir können sowohl etwas tun, um die Situation zu verbessern, z.B. auf die andere Person zugehen, und werden auch wieder frei voranzuschreiten und nehmen Einfluss auf unsere eigenen Gefühle.
3. Bei objektiver Schuld - gibt es etwas wiedergutzumachen? Wenn wir jemanden verletzt oder einen Schaden verursacht haben, sollten wir überlegen, wie wir Wiedergutmachung leisten können. Was braucht es in der Situation (was braucht die andere Person), um das Geschehene zu lindern oder zu reparieren? Ist eine Entschuldigung angebracht oder können wir konkret etwas leisten, um den Schaden auszugleichen? Auch: Was wollen wir verändern, damit die Situation sich in Zukunft nicht wiederholt?
4. Wie viel Verantwortung trage ich? - der Schuldkuchen Eine gute Übung ist, die verschiedenen Faktoren, die zu der Situation beigetragen haben, in ein Torten-Diagramm zu übersetzen. Auf ein Blatt Papier wird ein Kreis gemalt, in den verschieden große Teile ("Kuchenstücke") eingetragen werden. Diese spiegeln die verschiedenen Umstände, Voraussetzungen, beteiligte Personen etc., die vermutlich mit zu der Situation geführt haben. Auch der eigene Anteil wird eingetragen. Durch die Visualisierung wird klarer, dass immer mehrere Faktoren beteiligt sind und wie groß der eigene Einfluss gewesen ist.
5. Grenzen setzen. Wenn wir bemerken, dass die innere Stimme, die uns Schuld zuweist, sehr dominant ist und auf früheren Erfahrungen beruht, kann es auch angebracht sein, nur den Teil anzunehmen, für den man wirklich verantwortlich ist, und ganz bewusst den Anteil, den man nicht beeinflussen konnte, loszulassen. Es kann bedeuten, innerlich die Kontrolle über diesen Teil abzugeben. Das kann sehr erleichternd sein. Sind die alten Gebote immer noch angemessen? Oder wäre es besser, aus einer reifen Position heraus neue Grenzen zu setzen?
6. Mitgefühl - sich selbst und anderen verzeihen. Vielleicht der stärkste Punkt von allen im Umgang mit Schuldgefühlen ist, mich sich und anderen mitfühlend zu sein. Sich selbst auch als Menschen zu sehen, der Fehler und Schwächen hat und der wahrscheinlich nicht die Absicht hatte, jemandem zu schaden. Wie würden wir über unsere*n beste*n Freund*in denken, wenn er/sie in der gleichen Situation wäre? Würden wir ihm/ihr gegenüber verständnisvoll und mitfühlend sein? Und wenn wir selbst verletzt wurden: Können wir das gleiche Mitgefühl auch der anderen Person schenken?
Diese Aspekte sind als Anregungen zu verstehen, wie wir das schlechte Gewissen überwinden und zu mehr (Selbst-)Verantwortung finden können. Ich wünsche dir einen wertfreien Blick auf dich und andere und viel innere Gelassenheit.

Wie wir in Beziehungen kommunizieren
Damit wir uns in unseren Beziehungen verbunden fühlen, ist Kommunikation unerlässlich. Es stärkt und vertieft eine Beziehung, wenn wir in der Lage sind, uns konstruktiv auszutauschen, unsere Bedürfnisse mitzuteilen oder auch Konflikte offen anzusprechen. Und dennoch drehen wir uns in Gesprächen mit unseren Partner*innen häufig im Kreis, fühlen uns unverstanden oder reagieren sehr emotional. Wie finden wir in solchen Momenten wieder eine gute Gesprächsbasis und bleiben in Kontakt mit uns selbst und mit unserem Gegenüber?
Wer spricht gerade?
Wenn wir uns in einem Gespräch übermäßig angegriffen fühlen oder wir bemerken, dass wir sehr stark auf Äußerungen reagieren, kann es gut sein, dass wir emotional getriggert wurden. Obwohl sich an der Situation äußerlich nichts geändert hat, hat es innerlich einen wunden Punkt getroffen, bei dem wir oft nicht einmal genau sagen können, was es denn eigentlich war. Dann wiederholen sich innerlich bekannte Beziehungsmuster, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, und ein "altes Programm" spult sich ab. Beispielsweise erinnern uns ein Thema, eine Formulierung, die unser Gegenüber benutzt, ein Tonfall oder eine Geste an eine Situation aus unserer Kindheit, die wir als bedrohlich erlebt haben. In diesem Moment werden - unbewusst - alte Gefühle, die damals angemessen waren, wieder geweckt.
Wenn es unbewusst bleibt, wird unsere Reaktion entsprechend heftig ausfallen - passend zu der früheren Situation - und wir führen das Gespräch dann quasi aus kindlicher Perspektive weiter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir unsere*n Partner*in mit mehr Widerstand, Ärger oder Trauer begegnen, als wir es eigentlich möchten. Unsere Gefühle gehen mit uns durch. Wenn wir das bemerken, wäre es hilfreich, wenn wir einen Moment Abstand nehmen und uns fragen, wer gerade aus uns spricht; ob das noch wir als erwachsenes Gegenüber sind, oder ob es jüngere Anteile in uns sein könnten, die noch mit früheren Erfahrungen verbunden sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für unser*e Gesprächspartner*innen. Auch sie können unbewusst wieder in Kontakt mit alten Gefühlen und Erfahrungen gekommen sein.
Hilfreiche Schritte können dann sein, etwas Abstand zu nehmen, sich selbst und der anderen Person mit Mitgefühl zu begegnen und das Gespräch bewusst aus einer erwachsenen Perspektive fortzuführen. Wenn das in diesem Moment nicht möglich ist, dann zu einem späteren Zeitpunkt.
Grundlagen für eine gute Kommunikation
Die Basis für ein konstruktives Gespräch in einer Beziehung ist, dass sich zwei Erwachsene begegnen. Wenn wir darüber hinaus alte Gesprächsmuster nicht fortführen, sondern unsere Kommunikation verbessern wollen, gibt es noch weitere Aspekte, die dazu beitragen können:
- Die Gesprächspartner*innen hören aktiv zu: Grundlage ist, dass wir wirkliches Interesse an dem haben, was unser Gegenüber uns mitteilen möchte und dass wir versuchen, sie bzw. ihn zu verstehen. Aktives Zuhören meint grundsätzlich noch etwas mehr: Es ist eine Technik, bei zunächst einer nur zuhört und anschließend den Inhalt des Gesagten wiederholt, um zu prüfen, ob es so stimmt...
- Möglichst wertfreies Wahrnehmen und Sprechen: Beide Seiten können sich darin üben, wertfrei zu sprechen und wahrzunehmen. Statt bewertet zu werden oder selbst zu (ver)urteilen und in eine Position von Angriff oder Rechtfertigung zu fallen, entsteht vielmehr ein sicherer Rahmen, in dem freier und ehrlicher gesprochen werden kann. Dieser und die nächsten drei Aspekte orientieren sich an der Methode der Gewaltfreien Kommunikation.
- Gefühle wahrnehmen und benennen: Statt tief in die Gefühle einzusteigen oder sie wegzudrücken, ist hilfreich, sie wahrzunehmen und auszusprechen. Statt: "Schon wieder gibst du mir die Schuld an allem!" ist hilfreicher im Gespräch: "Ich bin traurig darüber, wie wir in letzter Zeit miteinander reden. Ich fühle mich allein und überfordert mit der Situation." o.ä. Ich-Botschaften unterstützen dabei das gegenseitige Verständnis.
- Bedürfnisse wahrnehmen und benennen: Um aber nicht bei den Gefühlen stehenzubleiben, sondern auch zu erforschen, worum es den Sprechenden jeweils geht, können die eigenen Bedürfnisse erforscht und genannt werden. Hinter dem Ärger liegt vielleicht das Bedürfnis nach mehr Nähe und Verbundenheit, hinter der Trauer kann das Bedürfnis mehr Respekt und Wertschätzung nach stehen... Werden die Bedürfnisse ausgesprochen, fällt es oft leichter, ein klärendes Gespräch zu führen.
- Eine Bitte oder einen Wunsch äußern: In manchen Gesprächen und Konfliktsituationen werden zwar wichtige Themen und Bedürfnisse angesprochen, anschließend bleibt aber unklar, was jetzt zu tun ist. Die Dinge offen auszusprechen und zu hören, worum es dem*der anderen geht, reicht manchmal schon aus, manchmal braucht es aber noch einen weiteren Schritt, um die Situation zu lösen. Möglich ist, eine Bitte an die andere Person zu formulieren, damit sich das Bedürfnis erfüllt.
- Zwischen Sach- und Beziehungsebene unterscheiden: Nehmen wir die Aussagen unseres*er Gesprächspartners*in auffallend oft persönlich und fühlen uns angegriffen, können wir auch nochmals prüfen, wie wir die Botschaften tatsächlich aufnehmen. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun unterscheidet dabei zwischen Sachinformations- und Beziehungsebene. Hören wir bei einer Äußerung vor allem die Sachebene, nehmen wir nur die Informationen auf, liegt unser Fokus mehr auf der Beziehungsebene, hören wir vor allem einen Hinweis über die Beziehung, z.B. "Wenn du das tust, bist du ein*e schlechte*r Partner*in." Dann wäre es gut, nochmals wirklich gut wahrzunehmen, was gesagt wurde, oder auch nochmals nachzufragen, wie es gemeint ist...
In der Kommunikation geht es nicht darum, alle Regeln zu befolgen und jederzeit alles richtig zu machen. Finde heraus, was dir hilft, in Beziehungen gut zu kommunizieren, und erlaube dir auch Unsicherheiten dabei. Ich wünsche dir eine lebendige und wertschätzende Kommunikation!

Wie bringe ich mehr Achtsamkeit in meinen Alltag?
„Schon wieder bin ich nicht dazu gekommen, mir Zeit für mich zu nehmen.“, „Ich könnte ausrasten vor Ungeduld!“ „Mein Tag ist so vollgepackt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“, Mein Chef hat mich mit seiner letzten Bemerkung echt verletzt.“ … Oft fällt es uns im Alltag nicht leicht, auf uns selbst und unsere Bedürfnisse zu achten oder auch mit intensiven Gefühlen gelassen umzugehen. Wir scheinen den äußeren Anforderungen und unseren Gefühlen ausgeliefert zu sein, geraten in Stress und wissen nicht, wie wir uns selbst beruhigen können.
Eine Möglichkeit, sich daraus zu befreien und sich wieder besser zu fokussieren, ist die Methode der Achtsamkeit. Die Idee der Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus, heute wird sie jedoch vielfach in therapeutischen Zusammenhängen eingesetzt. Eine Definition dafür ist: Achtsamkeit bedeutet, bewusst wahrzunehmen, was im gegenwärtigen Moment passiert, ohne es zu bewerten. Die Gedanken, die unbewusst immer wieder zurück in die Vergangenheit oder in eine sorgenvolle Zukunft springen, werden angehalten, und wir richten unsere Aufmerksamkeit wieder stärker auf das, was tatsächlich da ist, und sind mitfühlender mit uns selbst.
Achtsamkeit bringt viele Vorteile mit sich: Grundlegend kann man sagen, dass sie hilft, uns von unliebsamen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen (Gewohnheiten) zu distanzieren. Wir treten innerlich einen Schritt zurück und reagieren weniger überwältigt von bestimmten Situationen. Wir gehen mit uns selbst aufmerksamer um und indem wir uns weniger bewerten, behandeln wir uns selbst freundlicher. Nicht zuletzt werden wir freier, anders auf Situationen und Menschen zu reagieren, als wir es bisher gewohnt sind, wir können typische Verhaltensmuster durchbrechen, wenn wir es wollen.
Für mich gehört zum Weg der Achtsamkeit auch dazu, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, kleine Schritte zu machen, vor allem, wenn wir etwas Neues lernen wollen oder wenn uns etwas herausfordert. Es lohnt sich, sich mehr mit der Methode der Achtsamkeit zu beschäftigen, mich interessiert jedoch besonders, wie sich Achtsamkeit leichter in den Alltag integrieren lässt. Die gute Nachricht ist: selbst kleine achtsame Momente können sehr viel Wirkung haben.
9 Schritte, um mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen
1. Eine*n innere*n Beobachter*in installieren: Wenn wir anfangen, die Gegenwart bewusst nur wahrzunehmen, statt einzugreifen oder uns von unseren Gedanken und Gefühlen vereinnahmen zu lassen, können wir bemerken, dass es in uns eine Seite/eine Instanz gibt, die alles aufmerksam beobachtet, ohne mit den Erlebnissen „verstrickt“ zu sein. Diese Instanz können wir auch den oder die neutrale*n, wohlwollende*n Beobachter*in nennen. Sie sieht zum Beispiel unsere aktuelle Umgebung, die Bäume im Park, unseren Schreibtisch im Büro o.ä. und nimmt auch wahr, was gerade passiert, beispielsweise jemand lächelt uns an oder wir reagieren verärgert auf eine Bemerkung. Je häufiger du in den Beobachtermodus wechselst, desto häufiger kommt diese Seite zum Vorschein und dadurch entsteht bereits eine innere Distanzierung.
2. Den Atem beobachten: Meine Lieblingsmethode, um wieder in einen achtsamen Kontakt mit mir zu kommen, ist, für kurze Zeit meinen Atem zu beobachten. Denn bei der Methode der Achtsamkeit geht es auch darum, eine freundliche Beziehung zu sich selbst zu entwickeln. Drei oder vier Atemzüge lang nimmst du einfach nur wahr, wie du ein- und wieder ausatmest. Das klingt einfacher als es ist, denn wir sind es nicht gewohnt, mit unserer Aufmerksamkeit so konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Es geht dabei nicht darum, etwas zu verändern oder zu verbessern, sondern wirklich nur wahrzunehmen. Wenn du merkst, dass du gedanklich abschweifst, lenke deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf den Atem.
3. Gefühle bewusst wahrnehmen: Schon eine kleine Herausforderung kann es sein, nicht gegen unsere Gefühle anzukämpfen oder sie vermeiden zu wollen, sondern sie „einfach“ nur zuzulassen und zu beobachten. Auch hier hilft wieder der/die innere Beobachter*in: Es geht darum, eine freundliche und neutrale innere Haltung einzunehmen und das aktuelle Gefühl interessiert zu untersuchen. Wie fühlt sich der Ärger/das Traurige in uns an? Wo nehmen wir es im Körper wahr? Ist es groß oder klein? Bewegt es sich oder ist starr? … Wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Gefühle ein paar Momente lang zu erforschen, stellen wir oft fest, dass sie weniger bedrohlich werden. Wir nehmen eine Haltung der offenen Aufmerksamkeit ein und erleben dadurch auch, dass wir mehr sind, als unsere Gefühle („Ich kann meine Gefühle beobachten, also bin ich mehr als meine Gefühle“).
4. Den eigenen Körper wahrnehmen, scannen: Achtsamkeit ist eine absichtslose Praxis. Und so kann es eine achtsame Übung sein, eine kleine Zeit mit sich selbst zu verbringen und den eigenen Körper aufmerksam wahrzunehmen. Also: Alles aufmerksam beobachten, was gerade da ist, zum Beispiel ein Grummeln im Magen, ein Kribbeln in der linken Hand, den eigenen Herzschlag. Wird man aufmerksam auf den eigenen Körper, bemerkt man erst, wie viel eigentlich im Inneren „los ist“. Es führt dazu die Sinne von der Umgebung weg und wieder nach innen zu richten. Wer es gerne strukturierter mag, scannt die Teile des eigenen Körpers mit seiner Aufmerksamkeit langsam von unten nach oben (oder in die umgekehrte Richtung). Das bedeutet man lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Füße, dann die Unterbeine, die Knie… bis hin zum Kopf.
5. Eigene Bedürfnisse aufmerksam wahrnehmen. Im Alltag sind wir oft so mit unseren Aufgaben beschäftigt, dass unsere elementaren Bedürfnisse oft untergehen. Eine Möglichkeit, um gegenzulenken ist, sich die Frage anzugewöhnen: Was brauche ich gerade? Das können wir mehrmals am Tag tun oder auch besonders in Momenten, in denen wir merken, dass wir gestresst und belastet sind. Mögliche Antworten auf diese Frage können sein: Ein Glas Wasser, eine kurze Pause, mal wieder Atem holen, ein Telefonat mit einem*er guten Freund*in, mich kurz hinlegen und ausruhen, eine Umarmung… Welche kleine Sache kannst du in diesem Moment selbst tun, um dir ein Bedürfnis zu erfüllen – und dadurch aus dem Hamsterrad auszusteigen?
6. Pausen machen bzw. einhalten: Fast schon zur Definition von Achtsamkeit gehört, innezuhalten und dadurch das Karussell der Ereignisse, Gedanken und Gefühle zu unterbrechen. Wann war deine letzte Pause? Wie kannst du für einen Moment aus einer stressigen Situation aussteigen? Zum Beispiel indem du ein Fenster öffnest und die frische Luft atmest, durch einen kleinen Spaziergang oder auch durch eine Pause, in der du etwas trinkst oder isst. Mach es dir zu einer guten Gewohnheit, regelmäßige Pausen einzubauen, das kann auch am Morgen schon beginnen, wenn du statt wie gewöhnlich nach dem Aufstehen ins Bad gehst und später zur Arbeit startest, dir erst einmal eine kleine Zeit für dich nimmst, um dich freundlich zu begrüßen, etwas für dich zu tun oder für 5 Minuten deine Lieblingsmusik hörst…
7. Nichtstun: Ja, auch Nichtstun kann eine Achtsamkeitspraxis sein. :-) Eine der besten Möglichkeiten, um uns zu entspannen und zu entstressen ist, eine kurze Weile lang einfach nichts zu tun. Kennen viele von uns, machen wir aber dennoch häufig zu selten. Wann hast du das letzte Mal nichts getan und hast dich dafür selbst nicht verurteilt (mit Gedanken wie „ich bin faul“, „ich schaffe gar nichts“, „eigentlich sollte ich jetzt…“). Erlaube dir, unproduktiv und zweckfrei einfach Zeit zu verbringen. Das kann unter Umständen ein radikaler Befreiungsakt sein und deine gewohnten Muster auf den Kopf stellen. Zur Achtsamkeit gehört auch das Nichtreagieren, das bedeutet, weder auf die kritischen Stimmen im Kopf noch auf die scheinbaren Erwartungen von außen zu reagieren, und wahrzunehmen, wie es sich anfühlt.
8. Die eigenen Gedanken beobachten: Eine Möglichkeit, um Abstand von kritischen Stimmen und negativen Gedanken zu bekommen ist, die Gedanken bewusst zu beobachten. Also sich nicht den Stimmen im eigenen Kopf zu überlassen, sondern die auftauchenden Gedanken nacheinander zu identifizieren („Aha, da ist der Gedanke xy, interessant!“), ohne sie zu bewerten. Dadurch identifizieren wir uns nicht mehr mit unseren Gedanken (ich bin dieser Gedanken und er ist wahr“), sondern nehmen sie als das wahr, was sie sind, als reine Gedanken. Es braucht vielleicht etwas Übung, um sich auf diese Art von den Gedanken zu distanzieren, aber es genügt auch schon, sich beim nächsten Gedanken zu sagen: „Aha, das ist nur ein Gedanke“ und ihn dann bewusst wieder loszulassen.
9. Achtsamkeit in der Natur: Besonders leicht fällt es den meisten Menschen, in der Natur achtsam zu sein. Draußen fokussieren wir uns fast automatisch auf die umgebende Natur, grüne Wiesen, Bäume, frische Luft, oder auch unsere eigenen Bewegungen, unseren eigenen Rhythmus, der eben nicht getrieben ist und von außen vorgegeben wird. Unsere Aufmerksamkeit wird dadurch meist von selbst nach innen gelenkt und kommen wieder in Kontakt mit uns selbst. Wir gehen uns wieder frei; Spazierengehen ist dadurch oft auch ein Motor für unsere Kreativität, wenn unsere Gedanken eine Pause machen und wieder frei fließen können. Das Gehen selbst kann eine Achtsamkeitspraxis sein, aber auch der absichtslose Blick auf das, was schon da ist.
Diese 9 Schritte sind Möglichkeiten, um Achtsamkeit mehr im Alltag zu verankern. Sie sind als Anregungen zu verstehen – wenn du möchtest, beginne mit einem Impuls, der dich besonders anspricht. Du kannst dir auch eine Erinnerung einbauen, zum Beispiel „immer, wenn ich eine neue Aufgabe beginne, atme ich erst einmal dreimal durch“ oder oder oder… Viel Freude und Achtsamkeit mit dir und mit deinem Umfeld!

